Im letzten Sommer wurde ich gebeten, für die Absolventenzeitschrift der kulturwissenschaftlichen Studiengänge der Universität Hildesheim einen kleinen Text zu schreiben. Ich dachte: Schön, Texte schreiben, das kann ich. Ich mag Texte schreiben.
Außerdem verdanke ich der Uni eine Menge, und habe wenig davon zurückgegeben. Außerdem gab es, was mich etwas überraschte, tatsächlich auch Honorar. Alles passte zusammen. So lange, bis ich das Thema erfuhr: Netzwerke.
Die - klar - wichtig sind, vor allem wenn man in diesem irgendwas-mit-Medien-Berufsfeld arbeitet. Aber das ist weder mein Thema, noch meine Stärke, noch irgendetwas anderes. Ich nahm es trotzdem in Angriff, und versuchte, meine Schwächen durch einen charmanten, plaudrigen Ton wieder wett zu machen, und mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich habe beim Schreiben in bisschen was gelernt. Das reicht mir eigentlich schon. Vielleicht ja auch noch jemand anders. Wer weiß.
Im Originallayout kann man ihn übrigens hier lesen.
Knüpfstücke
Lose
Ideen zu alten und neuen Netzwerken
| Wir sind alle nur aus Knoten gemacht. Bild von hier. |
Manchmal
bekomme ich Facebook-Nachrichten, in denen Leute Unmögliches von mir
verlangen. So was wie: „Wir bräuchten noch einen Text über
Netzwerke. 10.000 Zeichen. Du hast vier Wochen, das ist doch ok,
oder? “
Ich
dachte: Netzwerke. An sich. Das stemmt doch kein Mensch.
Und
ich dachte: Warum ich? Ich bin nicht gut darin, gesehen zu werden.
Ich stehe meistens am Rand der Tanzfläche, mit einer Flasche Beck's
in der Hand. Da suchen die meisten Leute nicht nach mir, die meisten
Leute suchen dort nach gar nichts. Netzwerken ist mir suspekt.
Menschen sind mir suspekt.
Dann
aber kam eine zweite Facebook-Nachricht dazu, zehn Minuten später.
In der Nachricht stand etwas von einem Honorar. Da dachte ich: Es
ist eine Herausforderung. Vor denen habe ich mich noch nie gedrückt.
Und
ich dachte: Ich bin auch gut darin, bei diesen Gelegenheiten, wo ich
mit einem Beck's in der Hand am Rand der Tanzfläche stehe, als
letzter zu gehen.
Aber
dazu später.
Der
Ort spielt keine Rolle
Ich
weiß nicht, was ein Netzwerk ist. Ich weiß, dass es – in dem
Sinn, in dem ich es hier brauche – ein Knüpfstück aus
Verbindungen zwischen Menschen ist, mit Verbindungen, mit Knoten,
locker, ohne Hierarchien. Ein selbst organisierendes Knüpfstück aus
Menschen, die sich grundsätzlich nicht wirklich unsympathisch sind,
die sich gegenseitig Vorteile verschaffen, die sich Arbeit
zuschanzen, die sich gegenseitig als Verteiler nutzen. Verbindungen
zwischen Menschen, also die für den einzelnen leisten, was der
einzelne alleine nicht kann, oder die eine vorübergehende
Gemeinschaft bilden.
Mir
wurde in dem Zusammenhang ein Forscher namens Peter Kruse empfohlen,
ein Psychologe, der zur Theorie dynamischer Systeme forscht. Er ist
Zukunftsforscher, tourt mit komplizierten Diagrammen im Gepäck über Tagungen und erntet dort mit seinen Vorträgen immer frenetischenApplaus. Zuallererst aber ist er ein bärtiger, sehr freundlich
wirkender Mann, der mir mit einem Problem weiterhalf, das ich mit mir
herumschleppte, seit ich die Herausforderung dieses Textes angenommen
hatte: Wie das alles kleiner machen, verdaubar, beschreibbar? Über
welche Sorte Netzwerk schreiben? Diejenige, die man knüpft, wenn man
tatsächlich irgendwo ist? Das Netzwerk, dessen Basis halberinnerte
Unterhaltungen auf Vernissagen, Premieren, Lesungen, Konzerten
undsoweiter sind? Oder das andere, das große, das sich ja sozusagen
längst von den Körpern getrennt hat, das Netzwerk, dass in den
endlosen Kabeln, Serverkisten und Funkwellen wohnt, die sich quer
über Welt spannen? Nicht, dass man das wirklich trennen könnte,
aber trotzdem.
Als
ich einen Kruse-Votrag von allen diesen wahnwitzigen,
dreidimensionalen Diagrammen entkleidet hatte, die aus genauso
irrwitzigen Befragungen entstanden waren, kam es mir vor, als schaue
der bärtige Mann mir tief in die Augen, und sagte: „Mein Sohn, du
wirst nie die richtigen Antworten finden, wenn du die falschen Fragen
stellst.“
Für
die Dynamik, die Funktionsweise eines Netzwerks, für das, was es
soll – Informationen zu verbreiten, Menschen miteinander zu
verknüpfen - spielt es keine Rolle, wo das Netzwerk sich befindet.
Die Größe spielt eine Rolle, die Frequenz und – vielleicht - die
Qualität, im Sinn von: der Art der Aktivität der Mitglieder, es
spielt eine Rolle, wieoft und wieviel die kleinen Knötchen zwischen
ihren Verbindungen kleine Nachrichten, Ideen, kleine Datenmengen hin-
und herschicken. Ob das on- oder offline oder sonstwo passiert,
spielt keine Rolle. Im Prinzip.
„Aber
die Revolution“, sagte der bärtige Mann, „hat schon längst
begonnen.“
Netzwerkpflege
publizieren
 |
| Genau so, nur mit weniger Franzosen und mehr Internet. Bild von hier. |
Was
für eine Revolution eigentlich? Und das ist nicht ein zu großes
Wort für alle diese bekloppten Katzenbilder? Auftritt eines zweiten, großen Netzwerk-Weisen: „Ähnlich
wie vor 7000 Jahren im Anbeginn der geschriebenen Geschichte läßt
die Echtzeit-Ethnie sich heute am
Ufer eines großen Flusses nieder, des Livestreams“, schreibt Peter
Glaser, Journalist, Schriftsteller, leidenschaftlicher
Wortverdreher, hauptsächlich aber: Sammler, Archivar von Netzkultur,
und damit auch von Vernetzungskultur. Und was tut sie dort, die
Echtzeit-Ehtnie? Sie kommuniziert. Sie verbindet sich untereinander
auf Arten, die zu viele, zu vielfältig sind, um sie aufzuzählen.
Ganz einfach. „Denn Menschen interessieren sich nicht für
Maschinen. Menschen interessieren sich für Menschen“, schreibt
Glaser weiter. Die Revolution ist keine Revolution des Ortes – es
ist eine Revolution der Partizipation. Der Masse. Der Reichweite.
Eine Publikationsrevolution. Einmal, weil es einfacher geworden ist,
Ideen und Anliegen mitzuteilen. Dann aber auch, weil es viel
einfacher ist, das Netzwerk aufrecht zu erhalten. Denn: Ein Netzwerk
braucht Pflege. Ein Netzwerk muss sich selbst immer wieder
auffrischen, muss sich selbst vergewissern, dass es da ist. Man muss
immer mal kleine Datenpakete durchjagen: Ein gemeinsames Glas Wein
hier, ein Ausflug dort. Das gilt immer und an jedem Ort, in jeder
Welt. Nur: In der eigenartig-einzigartigen
Sender-Empfänger-Infrastruktur, die einschlägige
Vernetzungsangebote im Internet einem bieten fällt genau das viel
leichter, weil es sich nicht anfühlt wie die Arbeit, die
Netzwerkpflege macht. „Im Netz sind Medien nicht mehr nur Dinge,
die wir benutzen – wir leben heute in unseren Medien, auf Facebook,
Twitter, in Foren und Blogs. 'Sharism' nennt der chinesische Blogger
Isaac Mao, was die sozialen Medien und Communities antreibt – die
Lust daran, Dinge mit anderen zu teilen,“, sagt wieder Peter
Glaser.
Im
Netzwerk werden Daten geteilt: Ich selbst habe schon lange aufgehört,
die Leute auf meiner Facebook-Freundesliste als Freunde zu bezeichnen
– ich nenne sie Publikum. Und sie mich. Wir sind Knotenpunkte in
einem Knüpfstück, in dem jeder Sender und Empfänger ist, in dem
jeder ständig publiziert, sein Publikum über aktuelle Entwicklungen
in seinem Leben und über seine Interessen auf dem Laufenden hält,
in dem er fröhlich herzeigt, was er gemacht hat, was er gefunden
hat.
Magische
Quadrate
Es
geht gar nicht so sehr darum, dass ein Netzwerk nur im Netz
existieren könnte, noch nicht einmal darum, dass sich Dinge –
Bilder, Worte – nur im Internet viral verbreiten könnten. Es geht
nicht darum, dass das Internet eine völlig neue Mechanik
hervorgebracht hätte.
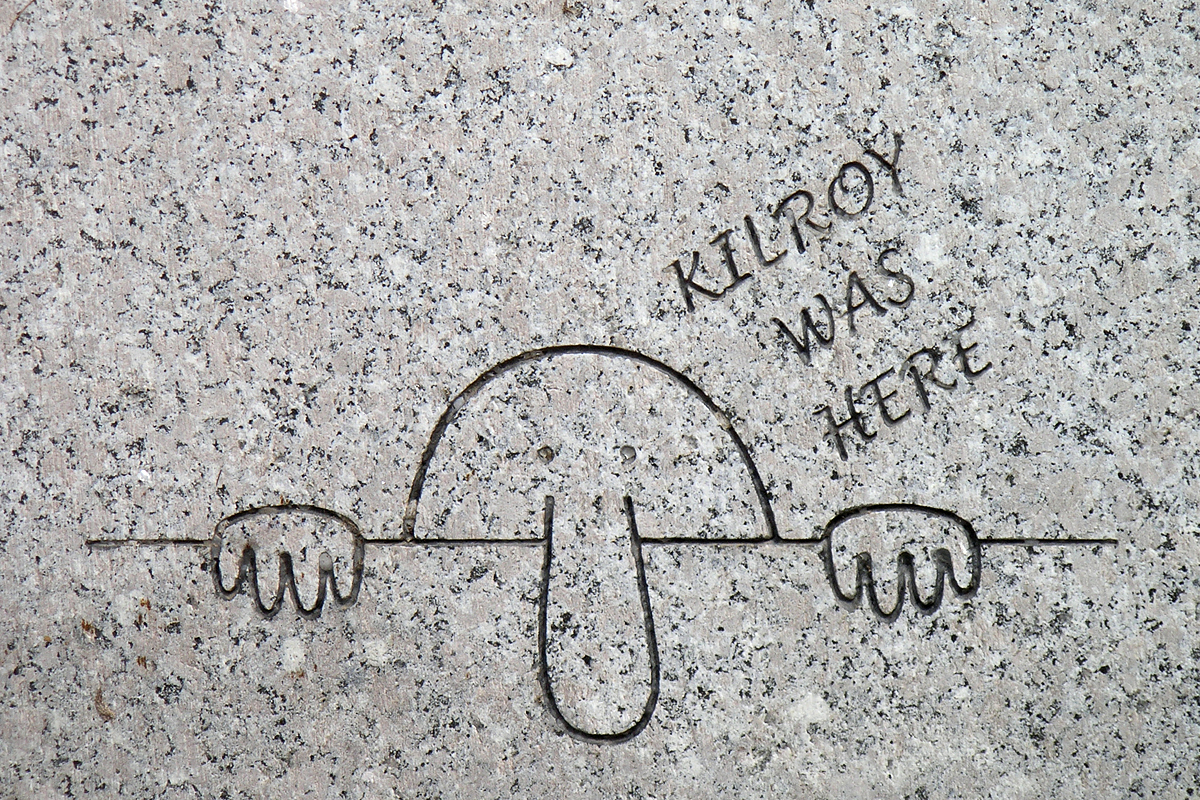 |
| Viral, bevor es viral gab. Bild von hier. |
Aus
der Zeit vor der Digitalisierung, aus dem zweiten Weltkrieg herum,
kennen wir den „Kilroy“, ein Bild, dass sich rasend schnell
verbreitete. Aus der Zeit vor den Massenmedien - aus dem alten
Pompeji - lässt sich das Sator-Quadrat anführen, ein Magisches
Quadrat, das heute in ganz Europa auf Kirchen, Grabsteinen und
historischen Gebäuden zu finden ist. Sie wanderten genauso durch die
Netzwerke, verbreiteten sich wie heutzutage Katzenbilder oder diese
leidige „Kony 2012“ Kampagne, die plötzlich an allen Ecken und
Enden aufpoppte.
Es
hat immer Menschen gegeben, die selbstgebasteltes – Fanzines,
Flugblätter – an den Informationsfiltern der etablierten Medien
vorbei durch ihre Netzwerke gejagt haben, weil sie der Meinung waren,
ihr Anliegen bräuchte Aufmerksamkeit. Es hat immer Leute gegeben,
die ihre Netzwerke dafür nutzen, an Jobs zu kommen, die ihre
Netzwerke zu ihren eigenen Vorteil nutzen, und sich für den Vorteil
anderer benutzen ließen.
Nur
ist heute die Infrastruktur besser, sind die Netzwerke größer und
leichter zu bedienen, ist die Verbreitung sehr viel einfacher und
schneller zu bewerkstelligen.
Das
interessante daran ist, dass die Netzwerke, die wir hatten, und immer
noch haben, sich nicht großartig geändert haben, wenn man einmal
von der Größe absieht – wir haben uns nur in sie hineinbewegt,
unseren Lebensraum in sie hinein verlängert: Die Netzwerkaktivitäten
sind näher an uns gewachsen, wir lagern Teile von uns – die es
ohne digitale Netzwerke vielleicht gar nicht gäbe – dorthin aus.
Wir
sind – das ist der Extremfall - noch dichter mit Infrastruktur
zusammengewachsen. Sie ist benutzerfreundlicher geworden, das
Netzwerke aus Menschen, mit denen ich verbunden bin, ist komfortabler
zu handhaben. Es
ist eine Infrastruktur, die genutzt werden will, und das heißt:
Gefüttert. Je größer, je schneller das Netzwerk ist, desto
hungriger ist es.
Aufmerksamkeit
Denn
wir lassen uns ja nicht nur am Echtzeit-Strom nieder: Wir befüllen
ihn. Wir sind seine Quelle. Wenn jeder ständig Sender und Empfänger
ist, wenn die Netzwerke ständig da sind, dann gibt es nur eines, was
sich lohnt zu generieren: Aufmerksamkeit. Die geheimnisvolle Kunst,
den Strom für kurze Zeit einmal anzuhalten, das eigene Anliegen, was
auch immer es sein mag, so zu präsentieren, dass es für andere
Mitglieder des Netzwerks anschlussfähig ist, die geheimnisvolle
Kunst, soviele Verbindungen, so viele Knötchen wie möglich zu
belegen.
Der
Gewinn? Ohne mein – in meinem Fall Facebook-Netzwerk - hätte ich
diesen Text nie geschrieben. Ich hätte viele andere Texte nicht
geschrieben, geschweige denn veröffentlicht. Ich wäre nicht
demnächst Herausgeber eines wunderbaren Buches. Ich würde nicht für
diese oder jene Zeitschrift oder Zeitung schreiben. Ich wüsste keine
Möglichkeit, meine Prosa, meinen Journalismus, alles dazwischen
irgendwo unterzubringen. Kurz gesagt: Ich wäre praktisch arbeitslos.
Und umgekehrt würde ich ins Leere produzieren.
Einen
letzten Rat würde ich gerne auch noch anbringen:
Wer auf der Partys in der Ecke steht, und als letzter geht, wer es
bleiben lässt, penetrant seine Netzwerke erweitern zu wollen, der
lernt die interessanteren Leute kennen. Wirklich.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen